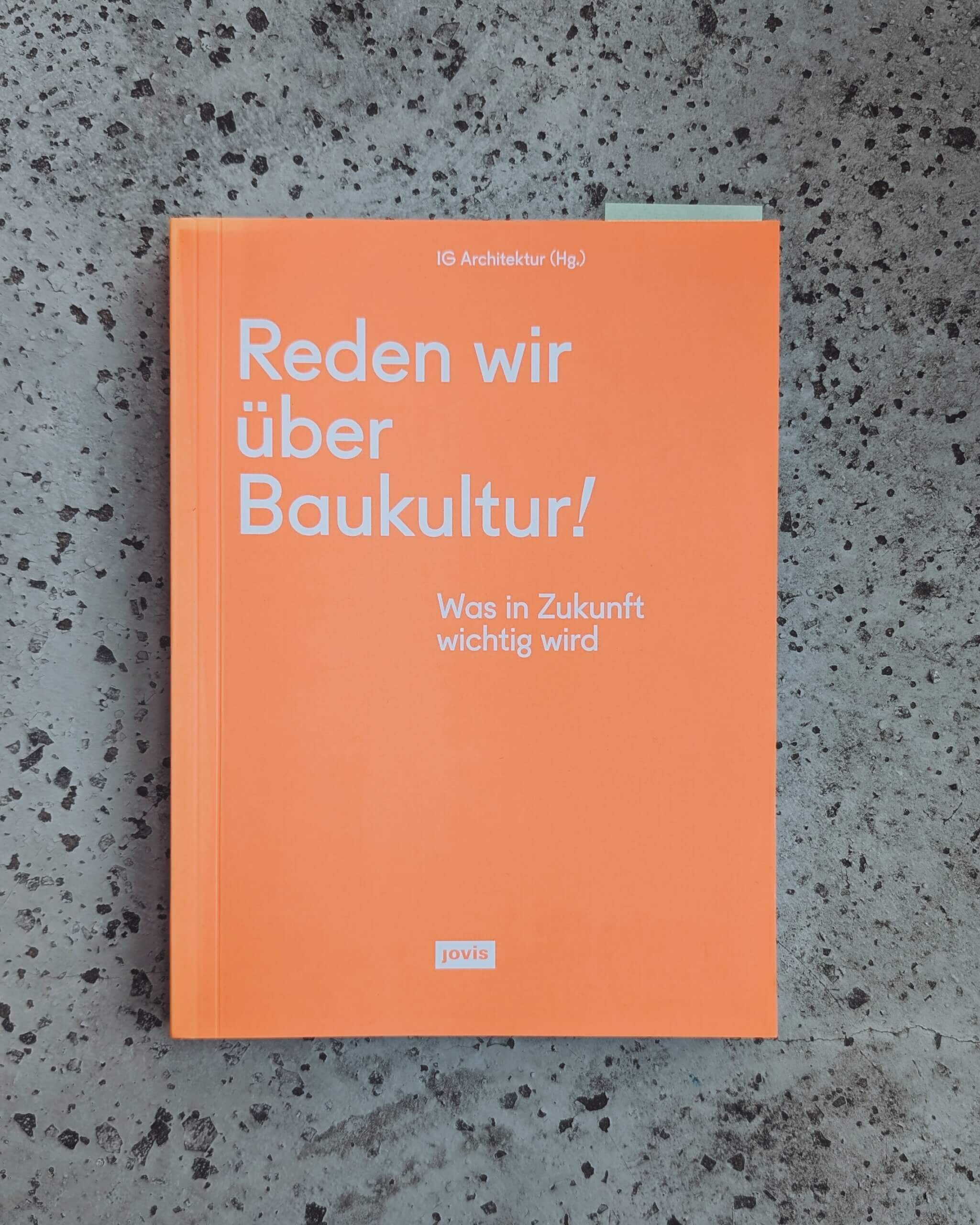WORK – Architekturarbeit im Wandel
Niedrige Löhne und Honorare, unzählige Überstunden und Wochenendschichten, und gleichzeitig fehlende Anerkennung der Leistung waren und sind die Themen, die immer wieder die Diskussion um die Produktionsbedingungen in der Architektur anheizen. Die Betonung hier liegt allerdings auf dem Wort Ausgangspunkt. Der thematische Dauerbrenner unter Architekt*innen ist – trotz der Dramatik für so viele in der Branche – scheinbar in den immer wieder gleichen Diskursschleifen verhaftet. Mich selbst beschäftigt das Thema der Produktionsbedingungen seit den ersten schlecht bezahlten Praktika, die ich durch Stipendien querfinanzieren konnte (und musste). Die sich daran anschließende Frage ist: Wie soll das weitergehen und welchen Wert hat meine Arbeit? Für viele junge Architekturschaffende beginnt die Auseinandersetzung mit dem Thema genau an diesem neuralgischen Punkt des ersten Eintritts ins Arbeitsleben.
Die Selbsterkenntnis des architect as a worker, wie es die US-amerikanische Architektin Peggy Deamer mit ihrer Arbeit bei der von ihr mitbegründeten Interessensvereinigung Architectural Lobby seit 2013 in den Fokus rückt[1], ist dennoch nicht überall angekommen. Der Mythos des Architekten als Künstler und kreativem Genie – weiß, männlich und wohlhabend – ist immer noch das vorherrschende Idealbild in den Syllabi der Universitäten und damit in den Köpfen der Studierenden. Doch dieses Bild entspricht schon lange nicht mehr der Realität und verkennt vielmehr die prekäre Arbeitssituation, der sich viele Architekt*innen heute ausgesetzt sehen.
Sich dem Thema Arbeitsbedingungen in der Architektur zu widmen, muss heute weit mehr heißen als nur über Gehälter, Honorare und Work-Life Balance zu sprechen. In der sich verändernden Realität des 21. Jahrhunderts müssen Architekt*innen neuen Anforderungen gerecht werden und ihr Berufsbild neu definieren. Angesichts der Klimakrise sowie gesellschaftspolitischer sowie wirtschaftlicher Veränderungen müssen Architekt*innen nicht nur ihre Entwurfsmethoden anpassen, sondern auch ihre Verantwortung in einem komplexen Netzwerk von Interessen und Akteur*innen reflektieren.
Ein holistischerer Blick, der über die eigenen individuellen Bedürfnisse hinausreicht, ist unabdingbar und birgt gleichzeitig das Potential für neue architektonische Praxen, wie das auch unlängst die im Dezember 2021 erschienene Ausgabe der Architekturzeitschrift ARCH+ zu zeitgenössischer feministischer Raumpraxis aufzeigte. Im Heft lässt sich die Verwobenheit und Komplexität der Themen ablesen: ökonomische, ökologische und gesellschaftspolitische Aspekte lassen sich nicht getrennt voneinander bearbeiten. Ebenso darin verwickelt ist die Architekturarbeit selbst ‒ oder wie es die Gastredakteur*innen der Ausgabe selbst schöner in der Einleitung zum Heft fassen:
„Noch nie war der Ruf nach Gleichstellung und der Chancengerechtigkeit innerhalb des hierarchisch organisierten und ökonomisch getriebenen Feldes konventioneller Architektur lauter als heute. Zwar mögen ihn nicht alle mit derselben Dringlichkeit vernehmen. Doch eine neue Generation an Praktiker*innen arbeitet über alle Bereiche der Disziplin hinweg aktiv an einem Wandel der Architektur – hin zu einer die Gesellschaft und Ressourcen schonenden, gleichsam ethischen Praxis. Dies ist umso dringlicher angesichts der globalen Herausforderungen der Gegenwart: von der Klimakatastrophe und Umweltzerstörung über Ressourcenknappheit, bis hin zur Verschärfung sozialer Ungleichheit, der Digitalisierung und Dekolonialisierung.“[2]
LIFE – Architektur-Diskurs
Man kann diese Fragen nun als zeitgeistige Debatte von Expert*innen abtun. Dass sich etwas tut, im echten Leben, zeigt sich allerdings auch im öffentlichen Diskurs. Das Argumentieren einer rein „gestalterischen Verantwortung“ und die Entpolitisierung der eigenen Arbeit für Architekt*innen wird schwieriger. Der Tod von migrantischen Arbeitern auf der Baustelle des Qatar FIFA World Cup Stadiums 2014 und die Schlagzeilen, die Zaha Hadid mit dem Abweisen jeglicher Verantwortung auslöste, waren der Beginn einer medialen Berichterstattung weit über Fachmedien hinaus. Auch die Geschichte dieser Arbeiter und deren Arbeitsbedingungen müssen inhärenter Teil des Diskurses sein, wenn wir über gerechtere Bedingungen von Architekturarbeit sprechen.
Inzwischen finden viele solcher Diskussionen – vor allem für eine junge Generation – in den sozialen Medien statt, und der Ton ist durchaus rauer geworden. Jaques Herzogs Aussagen zum Thema Verantwortung und Ethik in einem Guardian-Interview 2021[3] haben zu einem Shitstorm und diversen Memes geführt, die (Spoiler) Herzog & de Meuron nicht im besten Licht erstrahlen lassen. Im Zuge des Ukrainekriegs haben eine ganze Reihe an bekannten Büros, darunter auch Herzog & de Meuron, Stellungnahmen veröffentlicht und ihren Rückzug aus Projekten in Russland erklärt. Eine politische Positionierung und Einordnung der eigenen Arbeit – und damit der ökonomischen Abhängigkeiten – schien den Büros in diesem Kontext nötig. Eine Generation von Stararchitekten steht unter politischem Rechtfertigungsdruck.

Eine sich verändernde Debattenkultur und eine Vielzahl von Akteur*innen, die sich dem Thema der Arbeitsbedingungen widmen, heißt aber nun nicht automatisch, dass sich eine Branche unmittelbar wandelt. Arbeits- und Produktionsbedingungen konsequent zum Thema zu machen, sowie internationalen Austausch zu fördern, erhöht zumindest den Druck auf die gesamte Branche. Egal ob es nun @dank.lloyd.wright, die Future Architecture Front, Kontextur oder die IG Architektur sowie viele andere Akteur*innen[4] sind, denen Berufseinsteiger*innen gerade ihre Aufmerksamkeit schenken – die Auswirkungen der Vielzahl an neuen Formaten, Vernetzungsmöglichkeiten und Austauschwegen werden ihre Effekte zeigen. In Zeiten, die geprägt sind von Individualisierungstendenzen und Krisen, ist das Bauen neuer Allianzen selbst ein radikaler Akt.
BALANCE – Neue Praxis
Diese Allianzen können aber nur dann im Sinne von besseren (Arbeits-)Bedingungen für alle wirksam werden, wenn der größere Kontext, in dem Architektur entsteht, mitverhandelt wird. Welche Interessen stecken hinter der Architektur? Inwieweit macht man sich durch Gestaltung zur Kompliz*in von Profitmaximierung, Herrschaftsmechanismen, Ressourcen, Ausbeutung und so weiter? Der Übergang zu architektonischen Prozessen, die globale Zusammenhänge und Ungerechtigkeiten ökonomischer und ökologischer Natur berücksichtigen, stellt einen Paradigmenwechsel dar, der sich direkt auf die Organisationsstrukturen und Arbeitsbedingungen in der Architektur auswirken muss.
Anstatt einfach alles „effizienter und produktiver“ zu machen, um besser im globalen Kampf um knappe Honorare konkurrieren zu können, brauchen wir Vorschläge, wie wir die systemischen Bedingungen ändern, in denen wir Raum produzieren. Dazu gehört auch die Frage nach Wertschätzung und eine öffentliche Debatte außerhalb von Fachkreisen: Was ist uns als Gesellschaft gut gestalteter Raum, der allen zur Verfügung steht, wert?
Es gibt bereits Büros, die sich nach alternativen Maximen ausrichten. IFUB* Institut für u*(nvergleichliche) Baukunst arbeitet als Unternehmen auf Basis des Modells der Gemeinwohlökonomie, was sich auch in den architektonischen Konzepten des Büros widerspiegelt. Die erste Maxime im eigenen Handbuch: Nicht bauen.[5] Umsicht, Vielfalt und Spaß sind nur drei der sechs Kernwerte des Büros, was es zu einem Beispiel dafür macht, wie es anders gehen kann. Es lohnt sich, solche Modelle genauer in Augenschein zu nehmen und zu überlegen, wie sie sich übertragen, vervielfältigen und kopieren lassen. Es gibt nicht die eine Antwort auf all die Fragen, die ich in diesem Text anreiße.
Was es aber absolut geben kann, ist ein tragfähiges Narrativ, das wieder mehr Menschen dazu bringt, sich für qualitätsvollen Raum und dessen Gestaltung einzusetzen ‒ eine Idee, für die es sich zu kämpfen lohnt und die der nächsten Generation neue Wege in der Praxis aufzeigen kann. Ein Paradigmenwechsel vom Gegeneinander zum Miteinander, von Konkurrenz zu Kollaboration und vom Preisdrücken zu fairen Honoraren – nicht nur als Forderung nach außen, sondern auch als Selbstverständnis nach innen – sind die Eckpfeiler, für die wir uns noch immer einsetzen sollten.
[1] Die Interessensvereinigung Architecture Lobby wurde 2013 in den USA gegründet. 2015 publizierte Peggy Deamer das Buch The Architect as a Worker, eine Essay-Sammlung rund um die Architekturproduktion, welches heute als Standardwerk zum Thema gilt. Deamer, Peggy: The Architect as a Worker, Bloomsbury 2015
[2] Lange, Thorsten/Malterre-Barhtes, Charlotte/Ortiz dos Santos, Daniela/Schaad, Gabrielle: „Einführung“. In: ARCH+ 246: Zeitgenössische Feministische Raumpraxis. Dezember 2021, S. 4
[3] Moore, Rowan (31.10.2021): „Herzog & de Meuron: ‘Architecture is the art of facts. We shouldn’t have a moralistic standpoint’“. www.theguardian.com/artanddesign/2021/oct/31/herzog-and-de-meuron-m-plus-astrazeneca-national-library-of-israel-stadtcasino-one-park-drive-royal-college-of-art (letzter Zugriff 08.03.2022)
[4] Hierzu möchte ich die ARCH+-Karte auf dem Umklapper der Ausgabe 246 empfehlen, auf der man viele weitere Akteur*innen findet.
[5] Mehr zum Büro IFUB* findet man online unter: www.ifub.de/info (letzter Zugriff 14.03.2022)