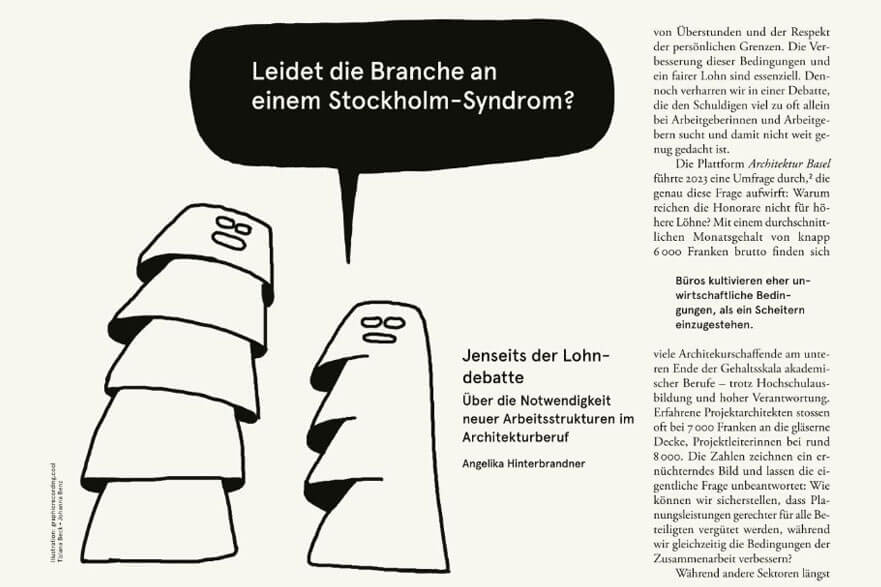Der Artikel erschien im Mai 2025 in der in der Werk Bauen Wohnen 3–2025 Care Architektur der Fürsorge
Vom niedrigen Lohnniveau bis zur Missachtung gesetzlicher Arbeitsstandards hört man angestellte Architekturschaffende oft klagen. Die Schuld ist schnell bei den Arbeitgeberschaften ausgemacht. Doch die sind damit konfrontiert, neben höherer Effizienz auch neue Wege finden zu müssen, den Mehr- und Marktwert der eigenen Planungsleistung geltend zu machen.
Druck, 5500 Franken Lohn, Nachtschichten – der Titel des Tagesanzeiger-Artikels im Februar 2024 fasst zusammen, wie die Lohndebatte in der Architektur aktuell geführt wird. Teile der Berufsgruppe, die als Arbeitnehmende lange keinen Raum in den (Architektur-) Medien bekommen haben, werden endlich gehört, wenn Sie über die Arbeitsbedingungen der Branche sprechen. Der Artikel schlug Wellen in der Szene, ist streitbar und geht gleichzeitig nicht weit genug.
Dass sich das Berufsethos in vielen Büros immer noch aus Härte und Leiden speist, ist für viele aus einer jüngeren Generation schwer verständlich. Ein Klima der Angst im Büro und Machtmissbrauch sind nie in Ordnung, nur «weil es immer schon so war». Dennoch verharren wir in einer Debatte, die den Schwarzen Peter viel zu oft allein bei den Arbeitgebenden sucht und damit nicht weit genug gedacht ist.
Arbeitsbedingungen sind schlecht, wenn man nicht darauf vertrauen kann, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich an gesetzliche Regeln und Standards halten: genügend Pausenzeiten, Vergütung von Überstunden und der Respekt der persönlichen Grenzen. Die Verbesserung dieser Bedingungen und ein fairer Lohn sind essenziell. Dennoch verharren wir in einer Debatte, die den Schwarzen Peter viel zu oft allein bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sucht und damit nicht weit genug gedacht ist.
Die Plattform Architektur Basel führte 2023 eine Umfrage durch,[1] die genau diese Frage aufwirft: Warum reichen die Honorare nicht für höhere Löhne?Mit einem durchschnittlichen Monatsgehalt von knapp 6 000 Franken brutto finden sich viele Architektinnen am unteren Ende der Gehaltsskala akademischer Berufe – trotz Hochschulausbildung und hoher Verantwortung, wie Juristinnen oder Ärzte. Erfahrene Projektarchitekten stossen oft bei 7 000 Franken an die gläserne Decke, Projektleiterinnen bei rund 8 000. Die Zahlen zeichnen ein ernüchterndes Bild und lassen die eigentliche Frage unbeantwortet: Wie können wir sicherstellen, dass Planungsleistungen gerechter für alle Beteiligten vergütet werden, während wir gleichzeitig die Bedingungen des Zusammenarbeitens verbessern?
Leidet die Branche an einem Stockholm Syndrom?
Während andere Sektoren längst neue Wege der Wertschöpfung und Abrechnung beschreiten (müssen), verharrt die Architekturbranche in gewohnten Strukturen. Anstatt unternehmerisch zu Denken und neue Einkommensmöglichkeiten zu gestalten, werden schlechte Honorare in Kauf genommen. Auch Büroinhaberinnen beuten sich selbst aus. Leidet die Branche an einem Stockholm Syndrom? Es scheint eine paradoxe Bindung an unprofitable Geschäftsunterfangen zu geben: Die Insolvenzhäufigkeit von Architekturbüros lag 2023 bei 0,37 Konkursen pro 100 Unternehmen, was 2023 deutlich unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 0,75 Insolvenzen pro 100 Unternehmen lag.[2] Dies könnte nahe legen, dass Büros Bedingungen kultivieren, als Scheitern einzugestehen..
Wie kann eine neue Geschäftsgrundlage von Planungsleistungen aussehen, um nicht nur gerechte Löhne, sondern auch eine zukunftsfähige Architekturpraxis zu etablieren? Das ist die zentrale Frage, die in den Mittelpunkt der Diskussionen innerhalb der Disziplin rücken muss. Man sollte sich diesen Prozess nicht durch Schockstarre aus der Hand nehmen lassen, solange das Potenzial besteht, ihn selbst zu gestalten.
Der Begriff «Geschäftsmodellinnovation» bezeichnet den Prozess, durch den Unternehmen in ihren grundlegenden Strukturen neu gestaltet werden. Dadurch schaffen sie neuen Mehrwert und gewinnen Wettbewerbsvorteile. Dabei werden zentrale Fragen wie die Zielgruppe, das angebotene Produkt oder die Art der Wertschöpfung und Einnahmequellen neu definiert. Disruptive Entwicklungen durch Technologiesprünge oder neue kulturelle Praxen können zu fundamentalen Veränderungen führen: Der Übergang von physischen Tonträgern zu Streaming-Diensten hat beispielsweise die Musikindustrie umgekrempelt. Nicht nur der Konsum von Musik hat sich radikal verändert, sondern auch die Einnahmequellen und Geschäftsmodelle der Branche. Wie man diesen Veränderungsprozess bewertet, ist eine zweite Frage. Man sollte sich den Prozess nicht durch Schockstarre aus der Hand nehmen lassen, solange das Potenzial besteht, ihn selbst zu gestalten.
Doch zurück zur Architektur. Das typische Geschäftsmodell eines Architekturbüros basiert auf dem Angebot von Planungs- und Entwurfsleistungen für Bauprojekte. Die Vergütung erfolgt in der Regel nach Honorarordnung und liegt irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent der Baukosten, abhängig von Projektgrösse und Komplexität. Die Profitabilität eines Architekturbüros hängt von der Effizienz der Prozesse ab.
Vielen Büros scheint unklar zu sein, was der spezifische Mehrwert ihrer eigenen Planungsleistung ist.
Was mir in der Architekturbranche oft begegnet, ist der Frust, dass andere Fachplanerinnen und Fachplaner für scheinbar weniger Aufwand mehr verlangen können. Gleichzeitig scheint vielen Büros nicht klar zu sein, was der spezifische Mehrwert ihrer eigenen Planungsleistung ist. Auf Consultingmodelle im Nachhaltigkeitsbereich wird bewundernd bis neidisch geblickt, weil sie es erlauben, allein für einen Vortrag oder Workshop das einzunehmen, was Architekturschaffende als Tagessatz verrechnen. Allein das Begreifen und Formulieren von Expertise scheint ein Hebel zu sein, um eine Zeile auf der Honorarnote hinzuzufügen. Dabei könnten Architektinnen und Architekten diese Kompetenzen ebenso aufbauen und als Leistungen anbieten.
Bei jungen und kleineren Bürostrukturen scheinen neue Akquiseformate zunehmend beliebt: Die Primäransprache von neune Bauherrinnen wird selektiver und beratender, was die Bauaufgabe umfassen soll oder Projekte werden direkt selbst initiiert anstatt allein auf offene Wettbewerbe zu setzen. Workshops zur Abgrenzung der Erwartungen werden entwickelt oder direkt eine «Phase Null» eingeführt, die separat verrechnet werden können. Einige schrauben auch an der Effizienz: Schnellere Abläufe, pragmatischere Entscheidungen beim Gestalten, mehr Projekte und Mitarbeitende. Durch Controlling lassen sich unrentable Projekte identifizieren und man kann Überstunden im besten Fall zuvorkommen.
Diese Modelle funktionieren nicht für jeden und alle. Aber sie zeigen, dass es Spielräume gibt ausserhalb und innerhalb der klassischen Honorarstruktur, um dennoch eng verknüpft mit Gestaltungsleistung zu arbeiten. Was sich ablesen lässt, ist ein Zuspitzung: Die grossen Büros setzen auf BIM, besseres Controlling und straffere Organisation, um mit Generalunternehmern mithalten zu können. Kleine Büros verwandeln sich in Boutique-Studios, die sich auf bestimmte Zielgruppen und Bauaufgaben spezialisieren. Dazwischen bleibt ein Gros des gebauten Raums, der von Gestalterinnen und Gestaltern vernachlässigt wird.
In diesem Spannungsraum lohnt es sich zu experimentieren und zu streiten, wo es hingehen soll: Wo stehen Architektinnen und Architekten in der Wertschöpfungskette und im Verhältnis zur Gesellschaft? Ist das Ziel den eigenen Einfluss zu maximieren oder lassen sich neue Formen der gemeinsamen Wertschöpfung entwickeln? Welches Modell gewährleistet, dass sowohl gutes Planen und Entwerfen als auch finanzielle Nachhaltigkeit gesichert sind? Wo ist die Balance zwischen Aufwand und Effizienz zu finden? Gerade Umbauprozesse und kreislaufgerechtes Bauen sind komplexer als der Standard Betonbau auf der grünen Wiese. Wer bezahlt für diesen zusätzlichen Aufwand, der – Stichwort Klimakrise - ein langfristiges Investment in die Qualität unserer Lebensräume ist? Welche Organisationsstruktur und welche Kompetenzen sind entscheidend, um in Zukunft unternehmerisch erfolgreich zu sein und dabei gute Architektur zu machen?
Die Spielräume, um möglichst qualitätsvolle Architektur zu ermöglichen werden auch politisch und kulturell gesetzt.
Der Revision innerhalb der Disziplin muss auch eine Auseinandersetzung mit den äusseren Einflüssen auf die Praxis folgen: Welchen Wert messen wir als Gesellschaft der Gestaltung unserer Umwelt bei, und wie viel sind wir bereit, dafür zu investieren? Die Spielräume, um möglichst qualitätsvolle Architektur zu ermöglichen werden auch politisch und kulturell gesetzt.
In der aktuellen Debatte spielt die Honorarordnung eine zentrale Rolle. Angesichts der Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und steigender Ansprüche an architektonische Leistungen wird an einer neuen Honorarordnung SIA 102 gearbeitet, die flexiblere Vergütungsstrukturen bieten soll. Im Zentrum steht auch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen allen am Bau beteiligten Fachpersonen. Ziel ist es, einen Kulturwandel herbeizuführen: Die Leistungen sollen nicht mehr nur einzelnen Disziplinen, sondern auch übergreifenden Funktionen wie Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung zugeordnet werden. Ob und wie sich Architekturschaffende hier etablieren können, bleibt offen.
Wir leben in Zeiten, die mit viel Wandel und gleichzeitig viel Verantwortung einhergehen und dem Ausloten, wie wir leben und arbeiten wollen. Planerinnen und Planer sollten sich nicht zu hyperkompetitiven Akteurinnen und Akteuren machen lassen, sondern gemeinsam über neue Strukturen nachdenken und diese Ideen nach aussen tragen. Die Umsetzung solcher Veränderungen erfordert ein Umdenken in der gesamten Baubranche als auch bei den Auftraggeberschaften. Es geht darum zu verstehen und zu kommunizieren, dass Architektur einen Mehrwert bietet, der sich nicht allein durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen fassen lässt. Das heisst allerdings nicht, dass man nicht wirtschaftlich über die eigene Praxis nachdenken sollte. Schönheit, durchdachte Gestaltung, langfristiger Mehrwert für die Umwelt, Räume, die das Zusammenleben fördern und vieles mehr: Gute Architektur hat ihren Preis.Die Branche muss aktiv an diesen Veränderungen mitwirken und darf sich nicht lähmen lassen.–
[1] Lukas Gruntz, «Normalität oder Skandal?», in: hochparterre online, 4.4.2023 www.hochparterre.ch/nachrichten/architektur/normalitaet-oder-skandal (abgerufen am 20.12.2024)
[2] Dun & Bradstreet, «Firmenkonkurse und -gründungen im Gesamtjahr 2023 in der Schweiz», in: Dun & Bradstreet Wirtschaftsinformationsdienst, 18. Januar 2024, https://hello.dnb.com/rs/145-JUC-481/images/CH_Konkurse-und-Gr%C3%BCndungen-Gesamtjahr-2023.pdf?version=0 sowie die Zahlen aus dem Jahr 2022: Dun & Bradstreet, «Insolvenzen Deutschland, Österreich, Schweiz im Gesamtjahr 2022», in: Dun & Bradstreet Wirtschaftsinformationsdienst, Januar 2023, https://hello.dnb.com/rs/145-JUC-481/images/DACH_Studie_Insolvenzen_2022_DE.pdf