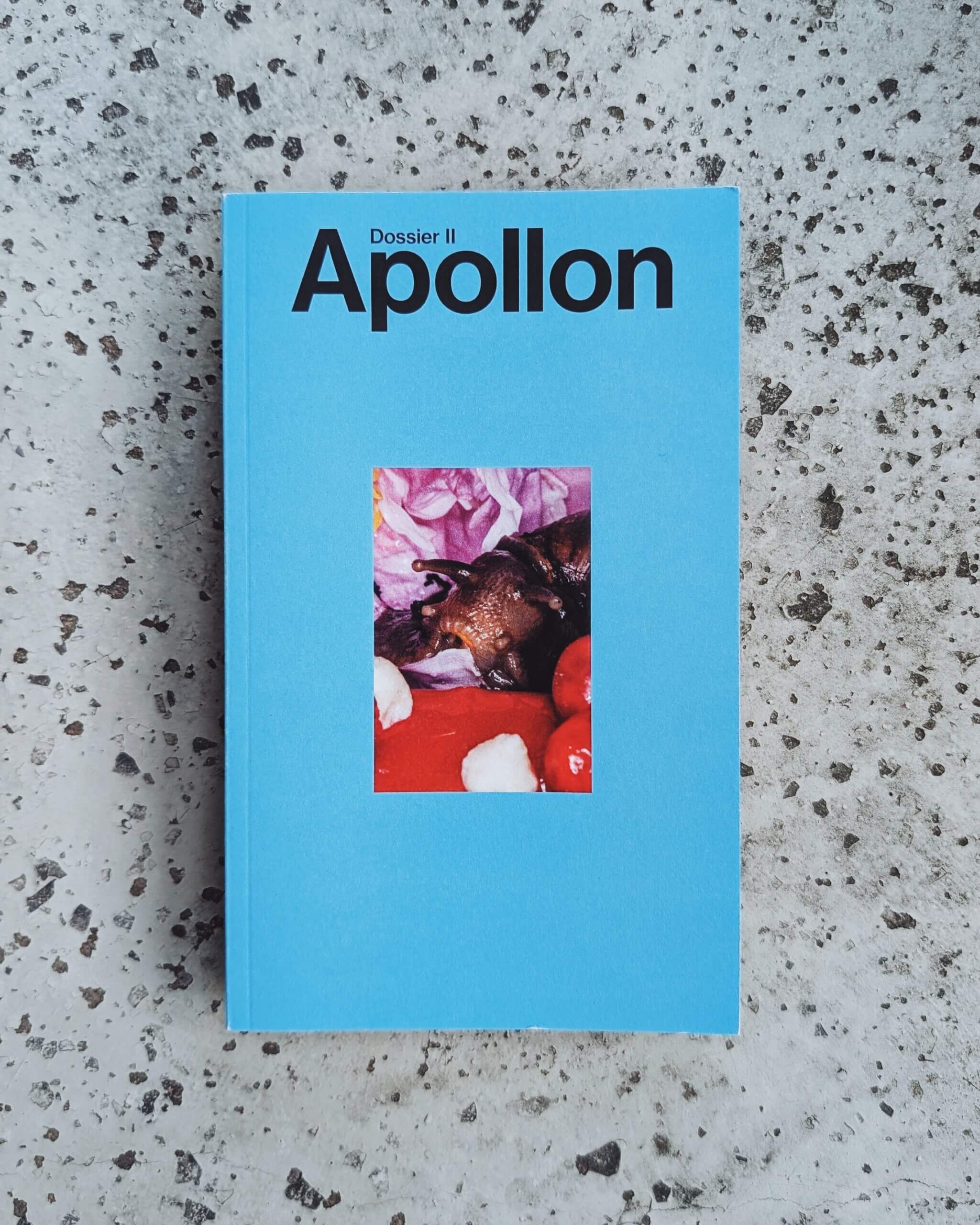Bauen ist ein schmutziges Geschäft. Vom Abbau der Ressourcen über die Arbeitsbedingungen auf Baustellen bis hin zur Einflussnahme der Immobilienlobby auf die Politik. Gleichzeitig wurden von Planer*innen immer wieder soziale Visionen des Zusammenlebens erdacht und in die Realität übersetzt – von den ersten Vorschlägen zum Sozialen Wohnungsbau wie dem Familistère in Nordfrankreich Mitte des 19. Jahrhunderts bis hin zu einer Vielzahl an experimentellen Bauten der sechziger und siebziger Jahre. Die 1985 fertiggestellte „Wohnmaschine“ Alt Erlaa in Wien, die noch heute trotz – oder gerade wegen – der enormen Dichte der Wohnblöcke zu den beliebtesten Wohnbauten der Stadt zählt, zeigt was soziale Utopie heißen kann. Beinahe zehntausend Menschen teilen sich unterschiedlichste Funktionen, eine Vielzahl an Gemeinschaftsräumen, eine Kirche, ein Einkaufszentrum im Gebäude und Schwimmbecken auf den allen Bewohner*innen zugänglichen Dächern. Jede Wohnung ist mit einem Balkon ausgestattet, die Fluktuation niedrig und die Wohnzufriedenheit äußerst hoch – auch wenn sich das vor dem Bau des Projekts so niemand vorstellen mochte.
Unser Zusammenleben wurde und wird durch gebauten Raum weiterentwickelt. Die enge Verknüpfung von kulturellen Ideen, ökonomischen sowie ökologischen Bedingungen – die komplexen Logiken, in die das Bauen heute eingewoben ist – wurden mit Ausbruch der Corona-Pandemie offen gelegt. Dem Moment des erzwungenen Stopps. Der französische Soziologe Bruno Latour schrieb am 29. März 2020, nachdem die Pandemie auch Europa erreicht hatte, in einem Onlineartikel: »Wenn alles angehalten wird, dann kann alles infrage gestellt, umgesteuert, ausgewählt, sortiert, endgültig unterbrochen oder im Gegenteil, beschleunigt werden… Das Letzte, was wir tun sollten, wäre, alles wieder genauso zu machen, wie wir es vorher gemacht haben.«Latour kritisiert in seinem Text die Produktionsmethoden, denen wir uns unterwerfen, und ruft dazu auf, bewusst zu reflektieren, wie es nach dem Innehalten der Welt weitergehen soll. Ein zeitlicher Bruch. Nichts ging mehr, aber die Baustellen liefen weiter. Das schmutzige Geschäft, das Wachstum, das Geldverdienen musste weitergehen.
A Global Moratorium on New Construction
Die Urbanistin Charlotte Malterre-Barthes initiierte aus diesem Widerspruch heraus gemeinsam mit dem Architekturbüro Brandlhuber+/b+ eine Reihe an Diskussionen unter dem Titel »A Global Moratorium on New Construction«, die den derzeitigen Modus Operandi und die Sprachlosigkeit der Architekturbranche zum Thema machten. Das Bauwesen stützt sich intensiv auf die Gewinnung von Ressourcen: Beton, Stahl, Glas und Ziegel sind nach wie vor die am häufigsten verwendeten Materialien, um Bauten herzustellen, zusammen mit einer Vielzahl von Produkten auf Erdölbasis, die beispielsweise als Dämmung zum Einsatz kommen. Damit ist dieser Wirtschaftszweig nicht nur Teil der ausbeuterischen Produktionsbedingungen, sondern hat auch erheblichen Einfluss auf das Klima. Der Bau und Betrieb von Gebäuden ist für etwa vierzig Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich und trägt damit wesentlich zu den globalen Umweltauswirkungen bei. Einen Baustopp halten bisher wenige in der Branche für das richtige Signal – klar, man beschneidet das eigene Geschäftsmodell, bei dem das Honorar an die Baumasse gebunden ist. Umso mehr gebaut wird, umso mehr wird verdient. Zurzeit kehren wir zur Geschwindigkeit des vorpandemischen Modus Operandi zurück, auch wenn der sonst so reibungslos laufende Motor Globalisierung durch seine stotternden Lieferketten die Preise nach oben treibt.
Der Glaube an Wachstum, von dem alle profitieren, an den wir uns klammern, ist die ideengeschichtliche Grundlage des neoliberalen Kapitalismus. Beschleunigung und Erneuerung sind eng verzahnt mit dieser Vorstellung. Je schneller, desto besser und effizienter. Nicht nur in der Architektur wird optimiert und verkürzt. Du bist deines Glückes Schmied, also schneller, höher, weiter. Los jetzt.
Die Zeit drängt, das stimmt auch in Bezug auf den Bedarf an Wohnungen, vor allem jedoch mit Blick auf die Klimakrise. Doch ist weiteres Wachstum, also mehr Ressourcenabbau, die Antwort, die wir darauf geben wollen? Vierhunderttausend neue Wohnungen sollen jährlich bis zu Beginn der nächsten Legislaturperiode in Deutschland gebaut werden, hunderttausend davon Sozialwohnungen. Die Dynamik der Baubranche wird angeschoben. Mehr schneller bauen. Doch wie viel Neubau brauchen wir eigentlich und vor allem wo? Welche räumliche Qualität bauen wir? Stellen wir die richtigen Fragen oder suchen wir an der falschen Stelle nach Antworten?
Das Anhalten, Stoppen und elementare Überdenken dessen, wonach wir streben, mag auch deshalb so schwerfallen, weil mit dem Abschied vom Glauben an Fortschritt und Zukunft traditionelle Zeitrichtlinien der Moderne – Schnelligkeit, Effizienz, infinitesimale Verwendung der Zeit – ihre Begründung verlieren. Es ist nicht mehr sinnvoll, mit allen Mitteln in die Zukunft zu streben, wenn diese keine Verbesserungsgarantie mehr enthält (und sogar umgekehrt ein erhöhtes Risiko der Totalkatastrophe in sich birgt). Ein Gegenvorschlag, der neue Visionen trotzdem zulässt, ist das bewusste Hinschauen. Was gibt es schon? Um Neues für die Zukunft zu schaffen, müssen wir heute vor allem mit dem arbeiten, was bereits vorhanden ist – viele Gebäude stehen leer oder werden nicht mehr genutzt.
Reuse, Reduce, Recycle
Das Thema des Erhaltens und Weiterentwickelns hat nicht nur wegen der gesellschaftspolitischen Dynamik eine Relevanz, sondern besonders auch, da zumindest in europäischen Städten die zu nutzende Infrastruktur und ausreichend gebauter Raum bereits vorhanden ist. Es gilt Zukunft so zu gestalten, dass Bestehendes in die Weiterentwicklung eingebettet werden kann.
Das gesamte verbaute Material im deutschen Gebäudebestand wird auf etwa fünfzehn Milliarden Tonnen geschätzt. Umnutzen und Neudenken heißt, diese Ressourcen weiter zu nutzen. Das Wiederverwendungspotenzial aller verbauten Rohstoffe im Bauwesen liegt heute gerade einmal bei circa sieben Prozent – das heißt, wenn wir abreißen, wandern im Durchschnitt dreiundneunzig Prozent der verbauten Materialien auf den Müll.
Damit entsorgen wir Materialien und Rohstoffe, die entsprechend dem aktuellen ökonomischen Verständnis gratis sind: Die Leistung der Natur, diese Ressourcen (wieder-)herzustellen – sogenannte Ökosystemleistungen – werden von Ökonom*innen in unserem Wirtschaftssystem schlicht mit null Euro berechnet. Viele materielle Ressourcen können sich im Zusammenspiel komplexer Ökosysteme tatsächlich regenerieren, jedoch werden mittlerweile nahezu alle Ressourcen auf der Welt übernutzt, weil wir zu schnell zu viel wollen. Seit den 1970er Jahren spitzt sich die Lage zu, der »Earth Overshoot Day« rückt jedes Jahr im Kalender weiter nach vorne. An diesem Tag übersteigt die menschliche Nachfrage nach Rohstoffen die Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen. Im Jahr 2021 haben wir bereits am 29. Juli so viele Ressourcen verbraucht, wie die Erde fähig ist, innerhalb dieses Jahres wiederherzustellen.
Da wir bisher kein System entwickelt haben, um die Leistungen des Ökosystems zu bepreisen – sprich in unsere ökonomische Logik einzuhegen –, gelingt es nicht, die Abbauprozesse in Relation zu setzen. Nicht nur diese Zahlen, auch die immer alarmierenderen Formulierungen in den Berichten des Weltklimarats machen deutlich, dass wir grundlegend umdenken müssen, um der Klimakrise auch und gerade im Bauwesen und der Architektur aktiv zu begegnen.
Dennoch wird weiterhin argumentiert, Umbau sei zu kostenintensiv, was nur dann stimmt, wenn man kurzfristig und -sichtig rechnet – oder anders gesagt: Mit Abriss und Neubau lässt sich schlicht mehr Profit machen. Was jedoch nicht eingerechnet wird, ist der Faktor Zeit: im bereits Gebauten gebundener Wert, sowie die graue Energie, die durch Abriss verloren geht sowie nachgelagerte Kosten, die der Allgemeinheit entstehen, sollte der Kohlendioxidausstoß weiterhin steigen. Die zugrunde liegenden ökonomischen und ökologischen Parameter sind heute immer noch viel zu selten Teil architektonischer Debatten. Solange wir lediglich die Kosten für den Abbau und nicht den von der Erde »kostenlos zur Verfügung gestellten« Ressourcen einen Wert zuweisen, wird Abriss und Neubau in der ökonomischen Logik stets profitabler sein.
Aus dieser Betrachtung lassen sich konkrete Forderungen ableiten: Ein geringerer Anteil an Neubauten wird benötigt, die langfristige und nachhaltige Nutzung und Umnutzung bestehender Gebäude sowie eine deutlich erhöhte Verwendung von Rückbaumaterial wird leichzeitig immer wichtiger. Diese Fokusverschiebung ist vor allem auch eine Frage der Gestaltung und damit eine inhärent architektonische. Der Ressourcenverbrauch sowie die Rückbaupotenziale werden zu einem großen Teil von Entscheidungen des Designs, der Konstruktionswahl und Detailausbildung sowie der Baumaterialien in der Planungsphase bestimmt. Eine solche Denkweise erfordert andere architektonische Visionen als bisher, die Bestehendes stärker einbezieht.
Hinzu kommt die Frage, ob man alles unter einer Verwertungs- und Profitmaximierungslogik betrachten will. Der im Gebäudebestand gebundene Wert kann auch ein kultureller, historischer und architektonischer sein. Aspekte, die sich nicht in Zahlen abbilden lassen und von wichtiger gesellschaftlicher Bedeutung sind.
Komplexität anerkennen
Sich das bewusst anzusehen, was es bereits gibt, und daraus neue Visionen zu entwickeln, ist kein neues Thema, aber ein vernachlässigtes. Anstatt blind Neues in den Raum zu stellen, wünsche ich mir umsichtige Weiternutzung im Sinne einer Integration von Komplexität: vom gestalterischen Anspruch an das gebaute Objekt über den urbanen Kontext bis hin zu den ökonomischen, ökologischen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die unsere gebaute Umwelt und damit unser Zusammenleben prägen. Sich dem Bauen neu anzunähern, zu analysieren und weiterzubauen – mit einem erweiterten Blick sowohl auf das bereits gebaute Objekt wie auf die Strukturen, in die es eingebettet ist –, zeugt von dem Bewusstsein einer Verantwortung gegenüber kommenden Generationen.
Die Politik steht in der Verantwortung, gemeinwohlorientierte und nachhaltige Strategien für die Entwicklung der vorhandenen Ressourcen, Flächen und Grundstücke bereitzustellen. Architekt:innen, aber auch die Zivilgesellschaft sollten diese Möglichkeiten bewusst einfordern und klug umsetzen. Zunächst gilt es, in komplexen Verflechtungen Potenzial zu erkennen, wo andere sich keines vorstellen können.